Erbse
| Warum schreiben wir Erbse mit b in der Mitte? Wir sprechen doch in der Mitte ein [p]. |
Diskussion
Erbse
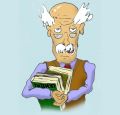
|
Diese Hülsenfrucht ist den Menschen schon seit vielen tausend Jahren bekannt. Die Griechen nannten sie erebinthos. Hier findest du den Anfang des Wortes Erbse wieder. Aus dem griechischen Wort wurde im deutschen Sprachraum araweiz oder arebeiz und später (ca. 12. Jahrhundert) dann erbeiz, erbīʒ (13. Jahrhundert). Von dieser Aussprache im Mittelalter zu unserer heutigen Erbse ist es dann gar nicht mehr so weit. |
| Bei vielen Wörtern kann beobachtet werden, dass sie in der Aussprache im Laufe der Zeit immer kürzer wurden. Meist fallen beim schnellen Sprechen einzelne Vokale weg. So ist es auch bei dem Wort Erbse und ebenso bei den Wörtern Herbst, Krebs und Obst. Nur an der Schreibweise ist die alte Aussprache noch zu erkennen. | |

|
Das Wort Erbse kommt in einigen Redensarten vor. Diese haben oft eine ganz interessante Geschichte zu erzählen.
|
Erbsenzähler
| Was ist ein Erbsenzähler? Zählt der wirklich Erbsen? |
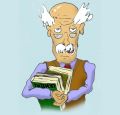
|
Ja, und nein zugleich.
Früher nannte man eine Person, die besonders geizig ist, in einigen Regionen Deutschlands auch Erbsenzähler. Damit war natürlich nicht gemeint, dass diese Person wirklich Erbsen zählt. Das Wort sollte vielmehr ausdrücken, dass diese Person nichts an arme Menschen abgeben will. Selbst Pfennige zählt sie wie so unwichtige Dinge wie Erbsen. Heute nennen wir solche Personen oft Geizhals oder Geizkragen. |
| Und dann gibt es noch eine Person, die wirklich Erbsen gezählt hat. Eine nette Geschichte aus dem Jahr 1847 machte diesen Erbsenzähler im ganzen Land bekannt. Aber diese Geschichte kann euch Herr Wort besser erzählen als ich. | |

|
Anfang des 19. Jahrhunderts lebte in Koblenz der Autor und Verleger Karl Baedeker. Er hat viele Reiseführer geschrieben. Karl Baedeker legte viel Wert darauf, dass in seinen Reiseführern alles bis ins Detail genau stimmt.
1847 wollte er einen Reiseführer über Norditalien schreiben. Also fuhr er nach Italien und sah sich alle Sehenswürdigkeiten genau an, um sie später in seinem Reiseführer beschreiben zu können. Ein guter Freund, Gisbert von Vincke aus Münster in Westfalen traf ihn im Mailänder Dom. Er erzählte von dieser Begegnung folgende Geschichte: |
| Wir bestiegen gemeinsam den Turm des Mailänder Doms. Dabei konnte ich beobachten, dass Karl (Baedeker) immer nach zwanzig Stufen stehen blieb. Er nahm eine Erbse aus seiner Westentasche und steckte diese in seine Hosentasche. Oben angekommen zählte er die Erbsen aus seiner Hosentasche. Es waren genau 9. Also: 9 x 20 = 180 plus 14 Stufen ganz oben. Um auf die Spitze des Turms zu gelangen musste man genau 194 Stufen hoch gehen. Als wir den Turm wieder hinunter gingen, machte Karl die Gegenprobe. Nun nahm er alle 20 Stufen eine Erbse aus der Hosentasche und steckte sie in die Jackentasche. Wenn keine Erbse zum Schluss in der Hosentasche war, blieben genau noch 14 Stufen. So prüfte Karl Baedeker, ob er beim Hinaufsteigen richtig gezählt hatte. | |

|
Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Baedeker war also ein richtiger Erbsenzähler, im wahrsten Sinne des Wortes. |

|
Ganz genau! Mit dieser Geschichte seines Freundes Gisbert von Vincke bekam das Wort Erbsenzähler eine ganz neue Bedeutung: Ein Erbsenzähler ist jemand, der ganz genau arbeitet.
Diese Geschichte war auch eine tolle Werbung für die Reiseführer von Karl Baedeker. Alle wussten: Wenn im Baedeker Reiseführer steht, dass der Turm des Mailänder Domes 194 Stufen hoch ist, dann sind es auch genau 194 Stufen und keine Stufe mehr und keine Stufe weniger. Auf die Angaben in Baedekers Reiseführer ist Verlass! |
| Allerdings: Ob sich Gisbert von Vinke und Karl Baedeker wirklich in Mailand getroffen haben, weiß man nicht genau. Vielleicht hat einer von den beiden diese Geschichte auch frei erfunden. Für die neue Bedeutung des Wortes Erbsenzähler spielt das aber keine Rolle. | |
Zurück zum Wort Erbsenzähler. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts zwei verschiedene Bedeutungen des Wortes:
Mit der Zeit vermischten sich die beiden Bedeutungen. Heute wird das Wort Erbsenzähler meist abwertend verwendet und meint jemanden, der übertrieben kleinlich, pingelig genau oder geizig ist. |
Prinzessin auf der Erbse
| Die Redensart wird für einen feinfühligen Menschen verwendet. Der Ausdruck kann aber auch abwertend gemeint sein. Dann meinen wir einen überempfindsamen oder pingeligen oder auch hochnäsigen Menschen. |
| Der Ausdruck stammt von dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen (erschienen im April 1837). Eine Königin und ein König suchten für ihren Sohn, den Prinzen, eine Frau. Eines Tages kam ein Mädchen an das Schlosstor und behauptete, eine Prinzessin zu sein. Um zu prüfen, ob das Mädchen eine wirkliche Prinzessin war, legte die Königin in das Bett des Mädchens eine Erbse und darüber zwanzig Matratzen und zwanzig Daunendecken. Am nächsten Tag fragte die Königin das Mädchen, wie es geschlafen habe: „Schrecklich”, sagte das Mädchen. „ich habe kein Auge zugetan. Es war, als ob ich auf etwas Hartem gelegen hätte.” Da wusste die Königin, dass dieses Mädchen eine Prinzessin sein musste. Denn nur eine Prinzessin konnte so feinfühlig sein, dass sie durch zwanzig Matratzen und zwanzig Daunendecken hindurch die Erbse spüren konnte. |
| Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Hans-Christian-Andersen-Schule, Wien |
Weiterführende Informationen
Modellwortschatz
Das Wort Erbse gehört zum Modellwortschatz (Karteikarte: Vorderseite, Rückseite).
Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.
Wortinformationen
| Aussprache | [ˈɛʁpsə] |
| Wortart | Nomen - die Erbse, die Erbsen |
| Adjektiv | erbsengroß |
| Bedeutungen | Gemüsepflanze, die Früchte wachsen in Schoten; Sowohl die Pflanze (1) als auch die Frucht (2) und der Samen (3) werden als Erbse bezeichnet. |
| Herkunft | griech. erébinthos (ἐρέβινθος) (Kichererbse), lat. ervum, ahd. arawī̌ʒ (9. Jh.), mhd. arwīʒ, areweiʒ, ereweiʒ (12. Jh.), spätmhd. erbīʒ (13. Jh.) |
| weitere Informationen | Erbse (Kinderlexikon), Erbse (Wikipedia), Die Prinzessin auf der Erbse (WDR) |
Wörterliste Erbse
Das Wort Erbse wird in zusammengesetzten Wörtern mit unterschiedlichen Bedeutungsgruppen verwendet:
- Im Sinne der Pflanze (Pflanzenstrauch, Hülsenfrucht, Samen),
- Im Bereich Essen (Erbsensuppe, Erbsenpüree),
- Tiere und Pflanzen (Erbsenkäfer, Erbsenrost)
- im übertragenen Sinn (Erbsenzähler, Erbsenbein) und weitere einzelne Bedeutungen (Erbsenpistole).
In der folgenden Tabelle sind die mit dem Grund- oder Bestimmungswort Erbse gebildeten zusammengesetzten Wörter nach diesen inhaltlichen Kriterien gruppiert. In der Regel sind die Wörter mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Die Bedeutungsgruppen 3 und 4 sind - soweit möglich - mit dem Stichwort in der Online-Enzyklopädie Wikipedia verlinkt.
Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). Dort findest du auch weitere Informationen zum Wort (Wortart, Aussprache, Bedeutung, Herkunft usw.)
Info - Erbsenzähler
Der Begriff: Erbsenzähler wird in drei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet.
- Im abwertenden Sinne: Ein geiziger Mensch.
- Im positiven Sinne: Sehr genauer arbeitender Mensch.
- Im abwertenden Sinne: Ein kleinlicher pingeliger Mensch
Für die erste Bedeutung gibt es schon sehr frühe Belege.
Bis ins 20. Jahrhundert war das Wort Erbsenzähler eines von vielen regional gebräuchlichen Wörter und Synonym für das ins hochdeutsche übernommene Wort Geizhals. Hier einige Beispiele für andere regional gebräuchliche Wörter: Erbsenzähler (rheinisch, pfäzisch), Grützzähler, Hääferlgucker (bayrisch), Hüpennig, Huzpott (niederdeutsch). Knauser, Knicker, Küssenpfennig (wienerisch), Lauser, Luseknicker, Pfennigfuchser, Sorteteller (niedersächsisch), Topfgucker (sächsisch) u. s. w. (siehe hierzu z. B. Johann Christoph Adelung 1793, Stichwort Geizhals oder Ludwig Aurbacher, Kap.19 $ 5). Erst nach der Anekdote von Gisbert von Vincke über Karl Baedeker (Ende 19. Jh.) wurde dieser Begriff im hochdeutschen Schrift- und Sprachgebrauch verwendet.
Beispiele für Erbsenzähler im Sinne von Geizhals: 1668 – Grimmelshausen, „Simplizissimus“, 1760 – Gotthilf Salzmann: Krebsbüchlein, 1793 – Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1830 – Simon Günzer – Dictionnair des Gallicismes, 1836 – Karl Simrock, Rheinsagen, 1842 – Ludwig Auerbach - Aus dem Leben und den Schriften …, 1852 – Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1860 – Jakob Grimm, Rede über das Alter, 1867 – Karl Friedrich Wilhelm Wander: Deutsches Sprichwörter-Lexicon, 1871 – Conrad von Bolanden: Franz von Sickingen.
Info - Erbsen in Märchen
Es gibt einige werbefreie Internetseiten mit frei zugänglichen Märchen. Hier drei Seiten mit umfangreichen Märchensammlungen: Wikisource, Zeno.org, Sagen.at. Auch im Projekt Gutenberg sind viele Märchentexte werbefrei und kostenlos gelistet.
Der Märchentext ist auf verschiedenen Internetseiten, z. B. Hans Christian Anderson: Die Prinzessin auf der Erbse (1837), auf Zeno.org, Sagen.at, Projekt Gutenberg, in der Version der Brüder Grimm: Die Erbsenprobe (1843), auf Wikisource
Erbsen spielen auch in einigen anderen Märchen und Sagen bzw. regionalen Geschichten eine Rolle. Hier ein paar Beispiele:
Bechstein: Deutsches Sagenbuch; Die drei Meister (1853)
Carl und Theodor Colshorn, Hannover: Die Zwerge im Erbsenfelde (1854),
Raimund Friedrich Kaindl: Rollerbsen (1888),
Zingerle, Ignaz Vinzenz, Sagen aus Tirol: Die Erbsen bei Leuchtenburg (1891)
Anna Croissant-Rust: Prinzessin auf der Erbse (1906), (Erzählung),
Sagenbuch aus Österreich und Ungarn: Der Erbsenfinder (1911)
Will-Erich Peukert: Niedersächsische Sagen: Die goldenen Erbsen (1968)
Reinhard Güll: Der Hummelkönig (2007)
usw. usf.
| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |



