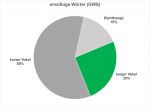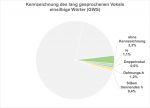Amtliche Rechtschreibregeln
| Der Doppelvokalschreibung ist im amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung ein Absatz in Teil A, Kapitel 1.3 gewidmet:
|
| § 9 Die Länge von [a:], [e:] und [o:] kennzeichnet man in einer kleinen Gruppe von Wörtern durch die Verdopplung aa, ee bzw. oo.
|
| Das betrifft Wörter wie:
aa: Aal, Aas, Haar, paar, Paar, Saal, Saat, Staat, Waage
ee: Beere, Beet, Fee, Klee, scheel, Schnee, See, Speer, Tee, Teer,
außerdem eine Reihe von Fremdwörtern mit ee im Wortausgang wie:
Armee, Idee, Kaffee, Klischee, Tournee, Varietee
oo: Boot, Moor, Moos, Zoo
|
| Zu die Feen, Seen siehe § 19.
|
| E1: Zu unterscheiden sind gleich lautende, aber unterschiedlich geschriebene Wortstämme wie:
Waage ≠ Wagen; Heer ≠ her, hehr; leeren ≠ lehren; Meer ≠ mehr; Reede ≠ Rede; Seele, seelisch ≠ selig; Moor ≠ Mohr
|
| E2: Bei Umlaut schreibt man nur ä bzw. ö, zum Beispiel:
Härchen - aber Haar; Pärchen - aber Paar; Säle - aber Saal; Bötchen - aber Boot
|
|
| Da nur eine begrenzte Anzahl deutscher Wörter mit Doppelvokal geschrieben wird, ist es unverständlich, warum im amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung diese Wörter nicht erschöpfend aufgeführt werden: Bei den Wörtern mit aa fehlen nur Maat und Maar, bei den Wörtern mit ee fehlen Beelzebub, Geest, Heer, leer, Lorbeer, Meer, Reede, Reep, Seele und bei den Wörtern mit oo nur doof und Koog. Außerdem wäre es sinnvoll, die Fremdwörter mit ee und oo in den Rechtschreibregeln gesondert aufzuführen und nicht mit den deutschen Wörtern zu mischen.
|
|
|
| § 19 Folgen auf -ee oder -ie die Flexionsendungen oder Ableitungssuffixe -e, -en, -er, -es, -ell, so entfällt ein e.
|
- die Feen; die Ideen; die Gletscherseen, des Sees; die Knie, knien; die Fantasien; sie schrien, geschrien; ideell; industriell
|
|
Wörter mit Doppelvokal
Entwicklung der Schreibung mit Doppelvokalen
| Einführung
|
| Die Doppelvokalschreibung kommt nur in 34 deutschen Wortstämmen vor. Sie ist somit ein nur selten auftretendes Phänomen innerhalb der deutschen Rechtschreibung.
|
| Entwicklung der Doppelvokalschreibung
|
| Diese Besonderheit in der Schreibung lässt sich leicht eingrenzen: In deutschen Wörtern kommt der Doppelvokal nur in einsilbigen Wörtern mit lang gesprochenem Vokal vor.
|
| Der Doppelvokalschreibung liegt ein ästhetisches Prinzip zugrunde: In der deutschen Schreibung gibt es keine bedeutungstragenden Wörter mit zwei Buchstaben. Um dieses Prinzip zu erhalten, wurden schon sehr früh Wörter mit nur zwei Buchstaben „künstlich“ durch Vokalverdopplung vergrößert (Al - Aal, Ar - Aar, As - Aas, Fe - Fee, Se - See). Dieses Prinzip wurde später auf andere einsilbige Wörter mit lang gesprochenem Vokal ausgedehnt, sofern dem nicht die Kennzeichnung mit h entgegenstand.
|
| Bei einsilbigen (bedeutungstragenden) Wörtern mit lang gesprochenem Vokal haben wir in der deutschen Schreibung drei konkurrierende Möglichkeiten:
|
- a) Doppelvokalschreibung
- b) Kennzeichnung durch h
- c) keine Kennzeichnung
|
| Bei einsilbigen Wörtern mit lang gesprochenem [e:] dominiert die Doppelvokalschreibung gegenüber der Schreibung mit Dehnungs-h. Ausnahmen sind hier: Lehm (abgeleitet von Leim), Mehl (abgeleitet von mahlen) sowie die Funktionswörter mehr, sehr und zehn.
|
| Bei einsilbigen Wörtern mit lang gesprochenem [o:] und [a:] wird vor l, m, n und r das Dehnungs-h gesetzt (siehe hierzu die Ausführungen zum Dehnungs-h). Ausnahmen sind hier: Moor (ndd. für Meer), Haar, Maar, Paar und Saal.
|
| Ausnahmen
|
| Es gibt in deutschen Wörtern nur drei Ausnahmen von der „Einsilbigkeitsregel“: Beere, Seele und Waage.
|
| Das Wort Beere ist eigentlich die Pluralform von Beer. Bis in 16. Jhd. hinein ist die Singularform das Beer belegt. Danach findet sich fast nur noch die Pluralform und später sozusagen der „Plural des Plurals“ Beere = die Beeren.
|

|
| Das Wort Waage wurde früher nur mit einem a geschrieben. Erst 1927 (auf Erlass des Reichsministers des Inneren) wurde die Doppelvokalschreibung Waage eingeführt, um dieses Wort vom Wort Wagen zu unterscheiden. Dieser Änderung liegt eine Fehlinterpretation des Unterscheidungsprinzips und der Gesetzmäßigkeit der Doppelvokalschreibung (Einsilbigkeit) zugrunde. Weitere Hinweise zum Wort Waage findest du auf der Wörterseite Waage. Klicke auf die Abbildung, um den Originaltext anzusehen und zu lesen.
|
| Das Wort Seele (ahd. sēula; mhd. sēle) dagegen hat eine sehr alte Geschichte: Nach altgermanischer Vorstellung wohnten die Ungeborenen und die Toten im See. Die Seelen sind „die zum See Gehörenden“. Im Wort Seele steckt also das Wort See und daher schreiben wir es mit ee. In diesem Falle kann die Doppelvokalschreibung als Ableitung gesehen werden, auch wenn der ursprüngliche Zusammenhang inzwischen verloren gegangen ist. Weitere Hinweise zum Wort Seele findest du auf der Wörterseite Seele.
|
Deutsche Grundwörter mit Doppelvokal
| Im Wortschatz der Grundwörter der deutschen Gegenwartssprache kommen folgende Wörter mit Doppelvokalen als besondere Kennzeichnung des lang gesprochenem Vokals vor:
|
| Wörter mit Doppelvokal (27): Aal, Aar, Aas, Beet, Boot, doof, Geest, Haar, Heer, Klee, Koog, Lee, leer, Maat, Meer, Moor, Moos, Paar, Saal, Saat, scheel, Schnee, See, Speer, Staat, (Tee), Teer, (Zoo)
|
| selten bzw. nur regional gebräuchlich: Aap, Deern, Fleet, Geest, Kloot, Koog, Kroop, Lee, Maar, Neer, Noor, Reede, Reep, Sood, Soor, Woog
|
| Zweisilbige Wörter mit Doppelvokal (3): Beere, Seele, Waage sowie selten bzw umgangssprachlich: alaaf, Beelzebub, Boofke, Zeese
|
| gebräuchliche Fremdwörter mit Doppelvokal: Fee, Idee, Kaffee, Moschee, Queen, Tee, Zoo Weitere Fremdwörter findest du in der Tabelle im Kapitel Fremdwörter mit Doppelvokal.
|
| Die folgende Tabelle listet (fast) alle Grundwörter mit Doppelvokal auf. Sie enthält auch Wörter, die nur regional gebräuchlich sind.
|
| Du kannst die Tabelle nach Spalten sortieren. Wenn du beispielsweise die erste Spalte sortierst, dann sind die Wörter nach dem Doppelvokal (aa, ee, oo) sortiert. Sortiere einmal die dritte Spalte. An der Anzahl der Wortbildungen, die mit dem Grundwort (Spalte 2) möglich sind, kannst du zugleich auch die Bedeutung eines Wortes erschließen. Können von einem Grundwort sehr viele neue Wörter gebildet werden, dann ist dies in der Regel auch für Schüler(innen) von besonderer Bedeutung. Das gilt nicht nur für die Wortbedeutungen, sondern auch für die Rechtschreibung.
|
deutsche Wörter mit Doppelvokal
| Vokal
|
Grundwort
|
Wortbildung
|
Alter
|
Herkunft
|
Bemerkungen
|
|
| aa
|
Aal
|
31
|
10. Jh.
|
mhd. āl; ahd. āl
|
außergermanisch nicht vergleichbar (wie viele Fischnamen), Herkunft unklar
|
|
| aa
|
Aap
|
0
|
?
|
ndd.
|
Besanstagsegel
|
|
| aa
|
Aar
|
12
|
8. Jh.
|
mhd. are, arn; ahd. aro, arn
|
Adler, großer Greifvogel
|
|
| aa
|
Aas
|
22
|
9. Jh./12. Jh.
|
mhd. ās
|
Aas (als Fraß, vor allem der Greifvögel), Köder; in der heutigen Bedeutung zurückgehend auf Zugehörigkeitsbildung ēdso- = als Fraß dienend
|
|
| aa
|
alaaf
|
0
|
17. Jh.
|
rhein. allaff
|
Karnevalsruf im Rheinland
|
|
| ee
|
Beel
Beelzebub
|
0
|
8. Jh.
|
ahd. beelzebub
|
Herkunft unklar; hebr. Ba‛al zewūw = Herr der Fliegen; oder hebr. Ba‛al zewūl = Herr des Himmels und daraus verächtlich beelzebub
|
|
| ee
|
Beere
|
128
|
8. Jh./16. Jh.
|
ahd. beri, mhd. ber, mndd. bere
|
Beere ist ursprünglich die Pluralform von ahd. daz ber = das Beer. Bis ins 16. Jhd. hinein ist die Singularform belegt. Danach findet sich fast nur noch die Pluralform und später sozusagen der „Plural des Plurals“ Beere = die Beeren.
|
|
| ee
|
Beet
|
19
|
8. Jh./16. Jh.
|
ahd. bettili(n), mhd. bette; md. beet
|
ursprünglich identisch mit Bett; erst seit dem 16. Jhd. Bedeutungs- und später auch Unterscheidung in der Schreibung
|
|
| oo
|
Boofke
|
0
|
?
|
preuß. Bowke, lit. bovytis
|
berlinisch ungebildeter dummer Mensch
|
|
| oo
|
Boot
|
197
|
13. Jh.
|
ndd. bōt
|
niederdeutsch aus der Seemannssprache; sonst nicht belegt
|
|
| ee
|
Deern
|
0
|
?
|
ndd. dērne
|
ndd. junges Mädchen, gleiche Herkunft wie südd. Dirndl
|
|
| oo
|
doof
|
6
|
?
|
ndd. doof
|
niederdeutsche Entsprechung zu hochdeutsch: taub
|
|
| ee
|
Fleet
|
4
|
10. Jh./14.Jh.
|
alt-nd. fliot, mnd. vlêt, vlît
|
schiffbarer kanalartiger Graben innerhalb einer Stadt
|
|
| ee
|
Geest
|
4
|
9. Jh./18. Jh.
|
ahd. geisinī, mnd. Mnd. gēst
|
hochliegendes Heidland über der Marsch; das Wort ist ursprünglich mit gähnen/gaffen verwandt.
|
|
| aa
|
Haar
|
274
|
8. jh.
|
mhd. hār; ahd. hār
|
Hornfäden, die auf den Körpern von Menschen und Säugetieren wachsen
|
|
| ee
|
Heer
|
113
|
8. Jh.
|
ahd. heri; mhd. her
|
ursprünglich das zum Krieg Gehörige; gr. koiranos = Heerführer, Herr
|
|
| ee
|
Klee
|
29
|
10. Jh.
|
ahd. klē(o); mhd. klē
|
vermutlich wegen des klebrigen Saftes vom Grundwort kleben abgeleitet
|
|
| oo
|
Kloot
|
1
|
?
|
ndd. klōt = Kugel
|
mit Blei ausgegossene Holzkugel; ndd. Kluten; Klootschießen (Sportart)
|
|
| oo
|
Koofmich
|
0
|
?
|
berlin. koofen
|
berlinisch = Kaufmann
|
|
| oo
|
Koog
|
1
|
19. Jh.
|
ndl. kaag
|
norddeutsch = Land vor dem Deich
|
|
| ee
|
krakeelen
|
8
|
15. Jh.
|
mnd. krakēl(e)
|
streiten, vermutlich von westfläm. kreel Lärm abgeleitet
|
|
| oo
|
Kroop
|
1
|
18. Jh.
|
ndd. krōp
|
norddeutsch = Wickelkind
|
|
| ee
|
Lee
|
6
|
17. Jh.
|
nl. ley
|
nl. Schutz, gegen den Wind geschützte Seite
|
|
| ee
|
leer
|
101
|
10. Jh.
|
ahd. l(e)āre; mhd. lære
|
vom Grundwort lesen (= auflesen, sammeln) abgeleitet; leer war demnach das Land, von dem schon alles aufgelesen (aufgesammelt) war.
|
|
| aa
|
Maar
|
2
|
20. Jh.
|
lat. mare
|
Kratersee; in der Schreibung angepasst an andere einsilbige Wörter mit Doppel-a
|
|
| aa
|
Maat
|
4
|
18. Jh.
|
aus ndd. māt = „Kamerad“
|
Marine-Unteroffizier
|
|
| ee
|
Meer
|
227
|
8. Jh.
|
ahd. mer(i); mhd. mer
|
See; abgeleitet von lat. mare = Meer und dies abgeleitet von idg. mori = Sumpf
|
|
| oo
|
Moor
|
45
|
9. Jh./17. Jh.
|
ahd. muor, ndd. mor
|
ursprünglich der Sumpf, das mit Moos bewachsene Land
|
|
| oo
|
Moos
|
34
|
8. Jh.
|
ahd. mos; mnd. mos
|
immergrüne, polsterbildende Moospflanzen
|
|
| ee
|
Neer
|
0
|
?
|
nordd.
|
Wasserstrudel mit starker Gegenströmung
|
|
| oo
|
Noor
|
0
|
?
|
dän. nor
|
Haff; dän. narv = Narbe, Vertiefung
|
|
| aa
|
Paar
|
199
|
13. Jh.
|
mhd. pār, par
|
zwei von gleicher Beschaffenheit
|
|
| ee
|
Reede
|
14
|
17. Jh.
|
mnd. rēde, reide
|
geschützter Ankerplatz
|
|
| ee
|
Reep
|
4
|
8. Jh./
|
ahd. reif, mnd. rēp
|
ursprünglich ndd. Wort für Seil
|
|
| ee
|
Reet
|
1
|
9. Jh.
|
ahd. (h)riot, mhd. riet, mnd. rēt, reit
|
Schilf, Riedgras
|
|
| aa
|
Saal
|
270
|
11. Jh.
|
mhd. sal; ahd. sal
|
Herberge, Speisezimmer. Das Wort bezeichnet ursprünglich den Innenraum des Einraumhauses.
|
|
| aa
|
Saat
|
48
|
8. Jh.
|
ahd., mhd. sāt
|
das Ausgesäte, ursprünglich: das, was aus dem Samen aufgeht; das Wort Saat hat demnach den gleichen Ursprung wie das Wort Samen
|
|
| ee
|
scheel
|
3
|
8. Jh.
|
ahd. skelah; mhd. schelch
|
schief, schräg; im Deutschen ist die Bedeutung auf eine Stellung der Augen übergegangen und aus scheel blicken wurde dann missgünstig, neidisch.
|
|
| ee
|
Schnee
|
200
|
8. Jh.
|
ahd. snēo; mhd. snē
|
in der Bedeutung ursprünglich von kleben, pappen abgeleitet
|
|
| ee
|
See
|
565
|
8. Jh.
|
ahd. sē(o); mhd. sē
|
die See = Meer, der See = Teich
|
|
| ee
|
Seele
|
186
|
8. Jh.
|
ahd. sē(u)la; mhd. sēle
|
abgeleitet von See, in der Bedeutung: die zum See Gehörenden
|
|
| oo
|
Sood
|
0
|
?
|
ndd.
|
Zisterne aus Warften
|
|
| oo
|
Soor
|
2
|
?
|
ahd. sohren
|
Pilzinfektion (weißgrauer Zungenbelag), ahd. sohren = verwelken, weitere Herkunft unklar
|
|
| ee
|
Speer
|
14
|
8. Jh.
|
ahd. sper; mhd. sper, spar
|
ursprünglich abgeleitet von Sparren, Balken
|
|
| aa
|
Staat
|
1071
|
14. Jh.
|
aus lat. status
|
übernommen aus frz. = état, nndl. = staat. = Gesamtheit der Beherrschten, beherrschtes Gebiet
|
|
| ee
|
Teer
|
38
|
16. Jh.
|
mnd. ter, tēre
|
durch trockenes Erhitzen von Kohle entstandene braunschwarze, klebrige Masse
|
|
| aa
|
Waage
|
42
|
8. Jh.
|
mhd. wāge; ahd. wāga
|
Die Schreibung mit Doppel-a wurde erst 1927 (Erlass des Reichsministeriums des Inneren) zur Unterscheidung von Wagen eingeführt.
|
|
| oo
|
Woog
|
0
|
10.. Jh.
|
ahd. wāg , mhd. wāc
|
ahd. = bewegtes Wasser (sh. Woge); südd. = stehendes Gewässer
|
|
| ee
|
Zeese
|
1
|
19. Jh.
|
ndd.
|
ein bes. Schleppnetz, das in der Ostsee verwendet wird; Zeesenboot
|
|
|
| Von den deutschen Grundwörtern mit Doppelvokal können fast viertausend neue Wörter gebildet werden. Hiervon entfallen auf die zwölf Wörter mit den meisten Wortbildungen rund 3.500 neue Wörter. Das zeigt, dass einige Wörter mit Doppelvokal für die Schreibung sehr bedeutsam sind.
|
| Neben diesen Wortbildungen kommen Doppelvokale auch in Familiennamen sowie Namen von Flüssen, Seen, Städten und Gemeinden vor. Hierbei hebt sich vor allem das Wort See von allen anderen Namen ab. Rund 200 Ortsnamen und 2.400 Gewässer enthalten das Grundwort See in ihrem Namen. Damit ist dieses Wort bei den Wortbildungen absoluter Spitzenreiter. (Die Zahlen in der folgenden Tabelle sind gerundete Annäherungswerte.)
|
|
|
Summe
|
aa
|
ee
|
oo
|
| Wortbildungen
|
≈ 4.050
|
≈ 2.000
|
≈ 1.700
|
≈ 350
|
| Flüsse
|
≈ 70
|
≈ 40
|
≈ 30
|
< 10
|
| Seen
|
≈ 2.600
|
≈ 50
|
≈ 2.500
|
≈ 70
|
| Orte
|
≈ 480
|
≈ 100
|
≈ 300
|
≈ 80
|
| Summe
|
≈ 7.200
|
≈ 2.200
|
≈ 4.500
|
≈ 500
|
|
Wortpaare
| Gleich klingende Wörter mit unterschiedlicher Schreibung: Zur Hervorhebung von unterschiedlicher Bedeutung werden einige gleich klingende Wörter unterschiedlich geschrieben. Bei Wörtern mit lang gesprochenem Vokal wird zur Unterscheidung bei einigen Wörtern ein Dehnungs-h bzw. ein Doppelvokal geschrieben. Dieses Phänomen tritt gelegentlich auch bei Ableitungen auf (z. B. er aß (Abl. von essen) - das Aas).
|
- Wortpaare mit Doppelvokal:
|
- das Heer - hehr (Adjektiv), her (Adverb, her- Präfix)
- die Leere (ohne Inhalt, Abl. vom Adj. leer) - die Lehre (unterrichten - Abl. von lehren)
- das Meer - mehr (Adverb, Pronomen, Zahlwort)
- die Reede - die Rede
- die Seen (Pl. von der See) - sehen (Verb)
- der Tee - T (Name des Buchstabens)
|
- das Boot - bot (Präteritum von bieten)
- das Moor - der Mohr (heute nicht mehr gebräuchliche und diskriminierende Bezeichnung für eine dunkelhäutige Person)
- der Woog, die Wooge (Plural) - die Woge (große Welle)
|
- Wortpaare mit Dehnungs-h:
- Buchstabennamen: eh - E, geh - G, oh - O, W/weh - W, Zeh - C
- hehr - Heer, ihre - Ire; Lehre - Leere; Mahl - mal, Mal; mehr - Meer; Mohr - Moor; Uhr - Ur-; Wahl - Wal; wahr - war; wahre - Ware; Wehr - wer
|
Einsilbige Wörter mit langem Vokal ...
Um die Grundwörter mit Doppelvokal von anderen Schreibungen abgrenzen zu können, werden in diesem Kapitel die verschiedenen Schreibungen des lang gesprochenen Vokals analysiert. Wörter mit einem lang gesprochenen [i:] werden in der Regel mit ie geschrieben. Im Wortschatz der Grundwörter der deutschen Gegenwartssprache betrifft dies ≈ 50 einsilbige Wörter. Diese Schreibung steht nicht in Konkurrenz zur Doppelvokalschreibung. Daher werden Wörter mit ie in diesem Kapitel nicht berücksichtigt. Ebenso unberücksichtigt bleiben einsilbige Wörter mit Diphthongen (≈ 170 einsilbige Wörter).
... ohne besondere Kennzeichen
| In der Regel wird der lang gesprochene Vokal in einsilbigen deutschen Wörtern nicht besonders gekennzeichnet.
|
| Adjektive (27): bar, blöd, dun, gar, grob, groß, grün, gut, hoch, klar, klug, los, rot, schal, schmal, schön, schräg, schwer, schwül, spät, stet, stur, süß, tot, träg, trüb, wüst
|
| Nomen (92): Bär, Blut, Brot, Bub, Buch, Bug, Dez, Dur, Fläz, Flor, Flöz, Flur, Fron, Fug, Fuß, Gas, Glas, Grad, Graf, Gram, Gras, Grat, Grus, Gruß, Hag, Hof, Huf, Hut, Kar, Köm, Kot, Kram, Kran, Kren, Krug, Kur, Lab, Lid, Los, Löß, Lot, Mal, Mär, Met, Mus, Mut, Not, Nut, Öl, Pfad, Pflug, Pup, Qual, Rad, Rat, Ruß, Schaf, Schal, Scham, Schar, Schlot, Schmach, Schmer, Schnur, Schoß, Schrot, Schur, Schwan, Schwof, Span, Spaß, Spat, Spuk, Spur, Stab, Star, Steg, Stil, Stör, Strom, Tag, Tal, Ton, Tor, Tran, Trog, Tuch, Tür, Uz, Wal, Weg, Wut
|
... mit Dehnungs-h
| Der lang gesprochene Vokal kann bei einsilbigen Wörtern auch mit Dehnungs-h geschrieben werden. Dies betrifft die folgenden deutschen Grundwörter:
|
| Wörter mit Dehnungs-h (51): Ahn, Bahn, Draht, fahl, Föhn, Hahn, hehr, hohl, Hohn, Huhn, ihm, Jahr, kahl, Kahm, Kahn, Kohl, kühl, kühn, lahm, Lehm, Lohn, Mahl, Mahr, Mehl, mehr, Mohn, Mohr, Ohm, Ohr, Öhr, Pfahl, Pfuhl, Prahm, Rahm, Rohr, Ruhm, Ruhr, sehr, Sohn, Stahl, Strahl, Stuhl, Uhr, Wahl, Wahn, wahr, wohl, Zahl, zahm, Zahn, zehn
|
| Bei einsilbigen Wörtern wird das Dehnungs-h nur gesetzt, wenn a) auf den lang gesprochenen Vokal ein l m n oder r folgt und zugleich b) vor dem lang gesprochenen Vokal nur ein einzelner Konsonant steht. Ein Dehnungs-h wird nie gesetzt, wenn der Wortstamm mit t beginnt (z. b. Tal, Tor). Von dieser Regel weichen nur ganz wenige Wörter ab. Diese sind in der Liste kursiv gedruckt.
|
| Einige Wörter, die mit Doppelvokal geschrieben werden, widersprechen dieser Regel zum Dehnungs-h. Dies betrifft: Haar, Heer, leer, Meer, Moor, Paar, Saal, Teer. Diese müssen daher als Ausnahmen betrachtet werden.
|
... mit Silben tennendem h
| Wörter mit Silben trennendem h am Wortende (17): buh (Verb: buhen), Feh (Nom.: Fehe), Floh (Nom.: Flöhe), froh (Adj.: froher), früh (Adj.: früher), jäh (Adj.: jäher), Kuh (Nom.: Kühe), mäh (sonst.: mähen), nah (Adj.: näher), Rah (Nom.: Rahen), Reh (Nom.: Rehe), roh (Adj.: roher), Schuh (Nom.: Schuhe), Stroh (Nom.: k. Pl., Gen. des Strohes), Vieh (Nom.: k. Pl., Gen. des Viehes), weh (Adj.: weher), zäh (Adj.: zäher)
|
| In einsilbigen Wörtern muss das Silben trennende h am Wortende stehen. Durch Verlängerung des Wortes (Plural und ggf. Genetiv, Komparativ) kann das Silben trennende h sicher von einem Dehnungs-h unterschieden werden.
|
Wortschatzvergleich
Verteilung der Grundwörter
| Setzt man die Schreibung einsilbiger Wörter in Beziehung zu allen einsilbigen deutschen Grundwörtern, so ergibt dies folgende Verteilung:
|
| Wortschatz
|
Anzahl
|
% dt. Grundwörter
|
% einsilbige Wörter
|
% lang gespr. Vokal
|
|
|
| Für die folgende Analyse wurde der Wortschatz der Grundwörter der deutschen Gegenwartssprache (sh. Wortfamilienwörterbuch von G. Augst) ausgewertet. Dieser Wortschatz wurde um einige für Kinder relevante Grundwörter ergänzt, die in diesem Wortschatz nicht enthalten sind. Insgesamt wurden rd. 8.500 Grundwörter ausgewertet. Hiervon sind 4.228 deutsche Grundwörter.
|
| Grundwörter (GWS) gesamt
|
4.222
|
100,0 %
|
|
|

|
| mehrsilbige Wörter
|
3.109
|
73,6 %
|
| einsilbige Wörter
|
1.113
|
26,4 %
|
|
| Etwas mehr als ein Viertel der deutschen Grundwörter sind einsilbig (= 26,4 Prozent).
|
| einsilbige Wörter
|
1.113
|
26,4 %
|
100,0 %
|
|
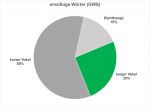
|
| kurz gesprochener Vokal
|
663
|
15,7 %
|
59,6 %
|
| Diphthonge
|
170
|
4,0 %
|
15,2 %
|
| lang gesprochener Vokal
|
280
|
6,7 %
|
25,2 %
|
|
| Bei etwa einem Viertel (= 25,2 Prozent) dieser einsilbigen Grundwörter wird der Vokal lang gesprochen. Bezogen auf alle Grundwörter sind dies 6,7 Prozent.
|
| lang gesprochener Vokal
|
280
|
6,6 %
|
25,2 %
|
100,0 %
|

|
| ohne Kennzeichnung
|
139
|
3,3 %
|
12,5 %
|
49,6 %
|
| ie
|
46
|
1,1 %
|
4,1 %
|
16,4 %
|
| Doppelvokal
|
27
|
0,6 %
|
2,4 %
|
9,6 %
|
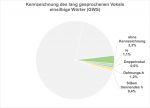
|
| Dehnungs-h
|
51
|
1,2 %
|
4,6 %
|
18,2 %
|
| Silben trennendes h
|
17
|
0,4 %
|
1,5 %
|
6,1 %
|
|
| Nur rd. zehn Prozent der mit langem Vokal gesprochenen einsilbigen Wörter enthalten einen Doppelvokal. Bezogen auf alle Grundwörter sind dies 0,6 Prozent bzw. nur 2,4 Prozent der einsilbigen Wörter. Diese Verteilung zeigt, dass die Doppelvokalschreibung insgesamt nur von sehr geringer Bedeutung ist.
|
| Interessant ist der Vergleich aller einsilbigen Wörter mit lang gesprochenen Vokalen. Die Hälfte (49,6 Prozent) dieser Wörter hat keine besondere Kennzeichnung des lang gesprochenen Vokals. Auch die Schreibung des lang gesprochen [iː] (=16,4 Prozent kann als regelhafte Schreibung angesehen werden. Insgesamt werden demnach bei zwei Drittel (= 66 Prozent) aller einsilbigen deutschen Grundwörter der lang gesprochene Vokal nicht besonders gekennzeichnet.
|
| Das restliche Drittel verteilt sich auf Wörter mit Doppelvokal (9,6 Prozent), Wörter mit Dehnungs-h (18,2 Prozent) und Wörter mit Silben trennendem- h am Wortende (siehe Diagramm 3).
|
Ausnahmeschreibungen
| Bei der Schreibung des lang gesprochenen Vokals konkurrieren drei Schreibungen: a) keine Kennzeichnung, b) Dehnungs-h, und c) Doppelvokal. Interessant (und vor allem für die Rechtschreibung von Bedeutung) ist, ob diese verschiedenen Schreibungen bestimmten Regeln folgen und welche Ausnahmen es hierzu gibt.
|
| Um dies herauszufinden wurden die deutschen Grundwörter der Gegenwartssprache ausgewertet.
|
| Vorbemerkung 1: Bei der Analyse werden Funktionswörter ausgeschlossen. Nicht aufgenommen wurden Funktionswörter, die gegen die Regel 2 (s. u.) verstoßen. Regelhaft wird das Dehnungs-h bei den Adverbien mehr, sehr und wohl sowie den Pronomen ihm, ihn und ihr und dem Zahlwort zehn gesetzt.
|
| Vorbemerkung 2: Verben enden in der Grundform auf -en, -eln oder -ern. Diese sind daher in der Grundform regelhaft mehrsilbig. Sie wurden in die Wortschatzanalyse der einsilbigen Wörter nicht mit einbezogen. Die Verben können nur in den Ableitungen (z. B. 1., 2., 3. Person Singular, 2. Pers. Plural) einsilbig sein. Ausnahmen sind die Verben tun und sein.
|
| Vorbemerkung 3: Ebenfalls nicht aufgenommen wurden Parallelwörter, da hiervon per Definition immer eines der beiden Wörter gegen eine der Regeln 2 oder 3 verstößt. Dies betrifft die Wortpaare Mal/Mahl, Ur/Uhr, Wal/Wahl, war/wahr, wer/Wehr (Regel 2) und Heer/her/hehr, leer/lehr, Meer/mehr, Moor/Mohr (Regel 3).
|
| Regelungen für die Kennzeichnung des Vokals in einsilbigen Wörtern:
|
| Regel 1 – langer/kurzer Vokal: Auf einen lang gesprochenen Vokal folgt nur ein einzelner hörbarer Konsonant.
|
Regel 2 Dehungs-h: Das Dehnungs-h kann nur
- a) vor den Konsonanten l, m, n und r stehen, wenn
- b) zugleich dem lang gesprochenen Vokal nur ein einzelner hörbarer Konsonant vorausgeht
- c) Das Dehnungs-h steht nicht, wenn der Wortstamm mit t beginnt.
|
| Regel 3 Doppelvokal: Der Doppelvokal kann nur in einsilbigen Wörtern vorkommen.
|
| Wie viele und welche Wörter verstoßen gegen diese Regeln?
|
| Verstöße gegen ...
|
langer Vokal
|
Dehnungs-h
|
Doppelvokal
|
| ... Regel 1
|
wüst
|
Öhmd, Öhrn
|
Geest
|
| ... Regel 2 a
|
bar, Bär, dun, Dur, gar, Kar, Köm, Kur, Mär, Öl
|
Mahd
|
Aal, Saal, scheel, Aar, Haar, Paar, Teer
|
| ... Regel 2 b
|
keine Ausnahme
|
drahn, Pfahl, Pfuhl, Pfühl, Prahm, Stahl, Strahl, Strähl, Strähn, Stuhl
|
Speer
|
| ... Regel 2 c
|
keine Ausnahme
|
keine Ausnahme
|
keine Ausnahme
|
| ... Regel 3
|
keine Ausnahme
|
keine Ausnahme
|
Beere, Seele, Waage; (alaaf, Beelzebub, Boofke, krakeelen, Zeese)
|
|
| In der Tabelle wurden seltene oder nur regional verwendete Wörter kursiv gedruckt. Lässt man diese Wörter einmal unberücksichtigt, dann ergeben sich nur wenige Ausnahmeschreibungen.
|
Fazit
| Nur rd. 20 Wörter können bei den einsilbigen Wörtern als Ausnahmen betrachtet werden. Das entspricht 1,7 Prozent im Vergleich zu allen einsilbigen bzw. 6,8 Prozent im Vergleich zu allen einsilbigen Wörtern mit lang gesprochenem Vokal. Eine recht überschaubare Gruppe an Ausnahmeschreibungen.
|
| 1. In der Regel werden einsilbige Wörter mit lang gesprochenem Vokal nicht besonders gekennzeichnet.
|
2. Folgt auf den lang gesprochenen Vokal ein l, m, n oder r und
- steht zugleich vor dem Vokal kein Buchstabe (z. B. Ohr, Uhr) oder nur ein einzelner Konsonantenbuchstabe (z. B. kühl, Lehm, Hahn, Rohr) so wird in der Regel nach dem Vokal ein Dehnungs-h geschrieben.
- Beginnt der Wortstamm mit t, so wird niemals ein Dehnungs-h geschrieben (z. B. Tal, Ton, Tor, Tür).
- Ausnahmen sind einige wenige Wörter mit pf (Pfahl) und st (Stahl, Strahl, Stuhl) vor dem Vokal. Hier dürfte nach der Regel 2 kein Dehnungs-h stehen.
- Ausnahmen sind weiterhin die Wörter bar, Bär, Dur, gar, Kur und Öl die nach dieser Regel mit Dehnungs-h geschrieben werden müssten.
|
3. Bei einigen wenigen einsilbigen Wörtern mit lang gesprochenem Vokal wird die Länge durch Verdopplung des Vokals gekennzeichnet.
- Dies betrifft auch die zweisilbigen Wörter Beere, Seele und Waage.
|
Hinweise für den Rechtschreibunterricht
| 1. Erst die regelhafte Schreibung, dann die Besonderheiten und Ausnahmen
|
- Bezogen auf die Vermittlung der richtigen Schreibung von Wörtern mit Doppelvokal ergibt sich aus der Analyse der Wortschätze folgende - für Schüler(innen) in der Grundschule - Vorgehensweise:
|
- Zunächst sollte die am häufigsten vorkommenden Regelungen vermittelt und gesichert werden:
|
- Grundregel: In der Regel wird der lang gesprochene Vokal in einsilbigen Wörtern nicht besonders gekennzeichnet (Besonderheit beim ie).
- Dehnungs-h: Bei einigen wenigen Wörtern (vor l, m, n und r nach einem einfachem Konsonanten) wird der lang gesprochene Vokal durch ein Dehnungs-h gekennzeichnet. Beginnt das Wort mit t, schreiben wie nie ein Dehnungs-h.
|
- Nachdem diese beiden Regelungen von der einzelnen Schülerin / dem einzelnen Schüler gesichert sind, können sie auf die Ausnahmen
- bei den Wörtern, die nicht mit Dehnungs-h bzw. gegen die Regel mit Dehnungs-h geschrieben werden, hingewiesen werden.
- Da die Wörter mit Doppelvokalen relativ selten vorkommen ist es sinnvoll, diese Wörter als Ausnahmeschreibungen zu vermitteln. Lediglich der Hinweis darauf, dass diese Schreibung fast ausschließlich bei einsilbigen Wörtern vorkommt, kann für die Schüler(innen) hilfreich sein.
|
- Selbstverständlich wird man entsprechende Fragen zur Schreibung eines Wortes auch schon vorher beantworten. Bei einigen Kindern kann ein Hinweis auf die korrekte Schreibung eines Wortes auch schon früher erfolgen. Beispiel: ein Kind schreibt :*Sal anstelle von Saal - kann die Lehrerin/der Lehrer bsp. erklären: Kinder schreiben das Wort häufig so wie du. Erwachsene schreiben es mit zwei a, Saal. Oder ein Kind schreibt *Se anstelle von See. Dann kann für einige Kinder die Ergänzung helfen: So wichtige Wörter wie Nomen haben immer mindestens drei Buchstaben. Wenn du nur zwei hörst, dann wird häufig der Selbstlaut (Vokal) verdoppelt. Wenn das Kind danach weiterhin *Sal oder *Se schreibt, dann ist dies immer ein Hinweis darauf, dass die gegebene Anregung zur korrekten Schreibung vom Kind noch nicht verarbeitet werden kann. Erneute Hinweise auf die richtige Schreibung oder das Anstreichen als Fehler führen in diesem Fall nur zur Verunsicherung des Kindes. Besser ist es, einfach abzuwarten, bis die Regelhaftigkeiten fest verinnerlicht (automatisiert) sind.
|
| 2. Erst die Grundwörter, dann die Wortbildungen
|
- Am Beispiel der Doppelvokalschreibung kann gezeigt werden, wie wichtig es im Unterricht ist, von den Grundwörtern auszugehen. Betrachtet man alle Grundwörter mit Doppelvokalschreibungen (einschließlich der relevanten Fremdwörter) so ergeben sich insgesamt rund 65 Wörter, die für Schülerinnen und Schüler in den Klassen 1 bis 6 von Bedeutung sein können. In verschiedenen Wörterbüchern (einschl. der Wörterverzeichnisse, die nur online verfügbar sind) lassen sich rd. 5.000 Wortbildungen erstellen (einschl. Prä- und Suffixen). Betrachtet man nur die für Kinder bedeutsamen deutschen Wörter, so ist das Verhältnis 25 zu rd. 4.000 Wörter noch größer.
|
- Wir sollten daher im Rechtschreibunterricht die Aufmerksamkeit der Kinder zunächst auf die richtige Schreibung der Grundwörter ausrichten. Wenn sie diese beherrschen, können wir ihnen im zweiten Schritt die Wortbildung (einschließlich Präfixe und Suffixe) vermitteln. Im Umkehrschluss lernen sie damit auch Wörter in ihre Bestandteile zu zerlegen. Damit erarbeiten sie sich zugleich eine Strategie, wie sie sich die richtige Schreibung von Wortbildungen erschließen können. Aus wenigen rechtschriftlich gelernten Grundwörtern (in diesem Falle rd. 65 Wörter) können sie nun auch die richtige Schreibung der hieraus gebildeten zusammengesetzten Wörter (in diesem Falle über 5.000 Wörter) selbst herausfinden.
|
- Genau darum geht es: Wir wissen nicht, welche Wörter die Kinder hören, lesen oder selber erfinden. Wir wissen nicht, für welche Wörter sich ein Kind interessiert und welche Wörter es schreiben will. Viel wichtiger als schwierige Wörter auswendig zu lernen ist es, den Kindern Strategien zu vermitteln, mit denen sie sich selbst die richtige Schreibung von Wörtern erschließen können.
|
- Es ist ein großer Unfug, wenn die Aufmerksamkeit der Kinder schon früh im Rechtschreiblernprozess auf zusammengesetzte Wörter ausgerichtet wird. Das führt nicht nur bei vielen Kindern zur Verwirrung, sondern kostet auch viel überflüssige Lernzeit.
|
Fremdwörter mit Doppelvokal
Fremdwörter aus der englischen Sprache
| Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts werden vor allem Wörter aus dem englischen Sprachraum in unsere Alltagssprache übernommen. Hierunter sind auch einige Wörter, die mit den Doppelvokalen ee und oo geschrieben werden. Andere Doppelvokale kommen in englischen Fremdwörtern nicht vor.
|
| Die englischen Fremdwörter mit ee werden in der Regel mit langem [iː] gesprochen, z. B. Feeling [ˈfiːlɪŋ], Jeep, Queen, Peeling, Teen. In Wörtern mit ee am Wortende wird das i auch kurz gesprochen, z. B. Bungee [ˈbandʒi], Frisbee.
|
| Die Buchstabenfolge oo wird in englischen Wörtern in der Regel mit langem [uː] gesprochen, z. B. cool, [kuːl] Food, Pool, Saloon, Skooter, Tattoo. Auch hier gibt es einige wenige Wörter mit kurz gesprochenem [ʊ], z. B. Boogie [ˈbʊɡi], Cookie, Foot(ball).
|
Fremdwörter aus der französischen Sprache
| Vom 17. bis 19. Jahrhundert war die französische Sprache die dominierende Sprache in Europa. Vor allem in dieser Zeit haben wir viele Wörter aus der französischen Sprache übernommen und später auch an die deutschen Schreibgewohnheiten angepasst.
|
| In dieser Phase der Schreibanpassung wurden vor allem Wörter, die in der französischen Sprache mit einem Akzent-Zeichen am Wortende (é oder ée) geschrieben werden, im deutschen mit ee verschriftet, z. B. Armee (frz. armée), Chaussee (chaussée), Dragee (dragée), Gelee (gelée), Idee (idée), Karree (carré), Klischee (cliché), Pralinee (praliné).
|
| Der Doppelvokal ee kommt in französischen Fremdwörtern in der Regel nur am Wortende vor. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die meist von lateinischen oder griechischen Wörtern abgeleitet sind, z. B. Galeere (frz. galère, it. galera, griech. galéa), reell (Ausspr. [ʁeˈɛl], frz. réel, lat. reālis).
|
Fremdwörter mit Doppelvokal aus anderen Sprachen
| Neben den Wörter aus der englischen und französischen Sprache sind nur wenige Wörter mit Doppelvokal aus anderen Sprachen in die deutsche Sprache übernommen worden.
|
| Beispiele: Makramee (it. Macramé < arab. miqram), Paneel (mnl. pannēl), Tee (nl. thee, südchin. tē).
|
| Darüber hinaus wurden einige Neubildungen in Fachsprachen (z. B. Biologie, Botanik) von lateinischen bzw. griechischen Wörtern abgeleitet, z. B. Azalee ([at͡saˈleːə], nlat. azalea, grich. (azaleos), Kaktee ([kakˈteːə], lat. cactus, Plural cacteae, griech. káktos). Die Buchstabenfolge ee am Wortende wird in diesen Wörtern getrennt gesprochen [eːə]. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Wort über die französische Sprache vermittelt wurden, z. B. Orchidee ([ˌɔʁçiˈdeːə], frz. orchidée, griech. orchis).
|
Wörterliste
Die folgende Wörterliste gibt einen Überblick über eingewanderte Fremdwörter mit Doppelvokal. Diese können leicht an der Mehrsilbigkeit, der Betonung und Aussprache als solche erkannt werden. Sortiere die Tabelle einmal nach der Herkunft (Spalte 3) oder Aussprache (Spalte 5) und vergleiche diese beiden Spalten miteinander. So kannst du herausfinden, wie regelhaft die Fremdwörter mit Doppelvokal ausgesprochen werden.
Doppelvokale, die in Fremdwörter nicht vorkommen
| Von einigen wenigen Ausnahmen und Eigennamen (z. B. Aachen, Den Haag) kommen in Fremdwörtern die Doppelvokale aa, ii und uu nicht vor. Ebenso gibt es in Fremdwörtern auch keine Verdopplung von Umlauten.
|
- Doppelvokal aa: Der Doppelvokal aa kommt in Fremdwörtern nicht vor. Vereinzelt werden Fremdwörter mit aa in Wörterbüchern aufgeführt, die meist aus Fachsprachen stammen, z. B. Djamaa,
|
- Doppelvokal ii: Der Doppelvokal ii kommt in Fremdwörtern nicht vor. Es gibt einige wenige Eigennamen (z. B. Hawaii) und Ableitungen (z. B. der Schiit(in), Abl. von Schia, arab. schi'at) mit ii. Vereinzelt werden (meist veraltete lateinische) Wörter mit ii in Wörterbüchern aufgeführt (z. B. obiit (lat), Torii (jap. torii).
|
- Doppelvokal uu: Der Doppelvokal uu kommt in Fremdwörtern nicht vor. Vereinzelt werden (meist veraltete) lateinische Wörter mit uu in Wörterbüchern aufgeführt (z. B. Duumvirat, Lituus). (Zur Buchstabenfolge uu in Wortbildungen siehe die Beispiele zum Suffix -um.)
|
Wortbildungen
| Es gibt einige Fremdwortpräfixe, die mit einem Vokal enden und Suffixe, die mit einem Vokal beginnen. Bei Wortbildungen mit diesen Präfixen und Suffixen kann es ebenfalls zu Buchstabenfolge mit zwei aufeinander folgenden gleichen Vokalen kommen. In diesen Fällen werden diese beiden Vokale in der Regel getrennt gesprochen. Hier einige Beispiele:
|
- Präfixe anti-: z. B. antiideologisch, Antiimperialismus, antiindustriell, antiinflationär, antiislamisch, antiisraelisch ...,
- Präfix de-: z. B. deeskalieren,
- Präfix extra-: z. B. Extraabgabe, Extraabteil, Extraanzug, Extraapplaus, Extraarbeit, Extraartikel, Extraaufführung, Extraaufgabe, Extraauftritt, Extraaufwand, Extraausgabe, Extraauto, Extraausstattung, ...
- Präfix multi: z. B. multiinstrumental,
- Suffix -ieren: alliieren ([aliˈʔiːʁən]), assoziieren ([asot͡siˈiːʁən]), dissoziieren ([dɪsot͡siˈiːɐ̯ən] initiieren ([init͡siˈiːʁən]), liieren ([liˈiːʁən]), variieren ([vaʁiˈiːʁən])
- Suffix -um: Kontinuum (lat. continuus), Individuum (lat. indīviduum), Residuum (lat.residuus), Triduum (lat. triduum) Vakuum (lat. vacuum)
|
Belege/Quellen
Wortschatzanalyse: Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo des Instituts für deutsche Sprache (IDS); Wiktionary: Wörter mit verdoppelten Vokalbuchstaben, Sprachnudel.de: Wörter mit Doppelvokal
Einsilbige Grundwörter mit Doppelvokal, Dehnungs-h, Silben trennendem h, Diphthonge: Wortfamilienwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache von Gerhard Augst, (1998)/ (2009), Die Grundwörter dieses Wortschatzes wurden für die Analyse um weitere und vor allem neuere relevante Grundwörter ergänzt.
Verlinkungen: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, (DWDS); Wiktionary, ggf. Wikipedia, Duden Wörterbuch online (nicht werbefrei)
Namen mit Doppelvokal: Städte und Gemeinden in Deutschland: destatis: Gemeindeverzeichnis; Wikipedia: Gemeinden in Deutschland, Liste der Städte in Deutschland, BB, BW, BY, HE, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH; Flüsse in Deutschland: Wikipedia: Liste von Flüssen in Deutschland, BB, BW, BY, HE, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH; Seen in Deutschland: Wikipedia: Liste von Flüssen in Deutschland, BB, BE, BW, BY, HE, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH
Rechtschreibregeln: Rat für deutsche Rechtschreibung: Regeln und Wörterverzeichnis, Amtliches Regelwerk der deutschen Rechtschreibung (PDF-Download)