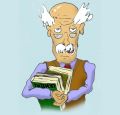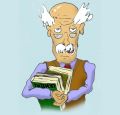|
Eine gute Frage, die letztendlich nur Herr Alt beantworten kann. Er ist nämlich im Rechtschreibteam für die Herkunft der Wörter zuständig.
|

|
Da bin ich gespannt. Ich komme nämlich auch immer durcheinander: die Waage, wiegen, die Wiege, etwas abwägen, vielleicht auch noch das Gewicht und bewegen. Wie hängt das alles zusammen? Oder vielleicht gibt es gar keinen Zusammenhang?
|
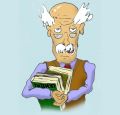
|
Irgendwie ja und zugleich auch nein. Das ist wirklich nicht einfach. Der Ursprung für beide Wörter liegt in dem germanischen Wort wigan, das ursprünglich sich bewegen, schwingen bedeutete.
|

|
Oh jeh! Können Sie, lieber Herr Alt, das bitte ganz kurz und einfach erklären? Das sollen doch auch Kinder verstehen (und ich natürlich auch).
|
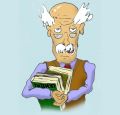
|
Also ich versuch's:
Die Germanen kannten das Wort *wēgō. Dieses Wort bedeutete bewegen, ziehen, fahren. Eine Waage, so wie wir sie heute benutzen, kannten die Germanen noch nicht. Diese haben sie erst durch die Römer kennengelernt. An Stelle des lateinischen Wortes haben ihre Nachfahren im deutschsprachigen Raum das alte germanische Wort genutzt. So wurde aus *wēgō in althochdeutscher Zeit (8. Jahrhundert) wāga und später wāge und noch später unser Wort Waage.
|
|
|
Auf den gleichen Ursprung können auch die Wörter bewegen, das Gewicht und auch das unregelmäßige Verb wiegen (im Sinne von etwas abwiegen) zurückgeführt werden. Die Ableitungen zu diesem Verb findest du im Kapitel Hinweise zum Wort.
|
|
|
Wenn jemand etwas auf die Waage legte, um das Gewicht zu bestimmen, dann nannte man diese Tätigkeit wägen.
|
|
|
Die 2. und 3. Person Singular des Verbs wägen hieß im Mittelalter: du wigst, er wigt. Im 16. Jahrhundert hat sich diese Form auch als Grundform (Infinitiv) wiegen durchgesetzt. Jetzt erst wurde auch die Schreibweise mit ie, in Angleichung an andere Wörter mit lang gesprochenem [i:] eingeführt. So wurde aus dem Verb wägen unser heute gebräuchliches unregelmäßiges Verb wiegen.
|
|
|
Das Wort die Wiege ist erst später entstanden. Das germanische Wort *weug- ist ein Nomen. Es bezeichnete das Schaukelnde oder das sich Bewegende. Daraus hat sich dann die Wiege (althochdeutsch wiega, 12. Jahrhundert) entwickelt. Sehr viel später (Ende des 15. Jahrhunderts) wurde hieraus das regelmäßig Verb wiegen abgeleitet.
|

|
Aha! Jetzt verstehe ich auch das Problem. Es gibt das Wort wiegen zweimal. Einmal bedeutet es: etwas mit einer Waage abwiegen (unregelmäßiges Verb). Das gleiche Wort kann aber auch bedeuten etwas hin und her bewegen z. B. ein Baby in einer Wiege schaukeln (regelmäßiges Verb).
|
| Das ist auch zugleich die Antwort auf die Frage von Jonas:
|
|
|
Das Wort Waage war zuerst da. Später ist das Verb wiegen (im Sinne von abwiegen) hinzugekommen. Nun wäre es ja Unsinn gewesen, die Waage in die Wiege zu ändern. Außerdem gab es die Wiege ja schon.
|

|
Lieber Jonas, hilft dir diese Antwort weiter?
Und wie ist es mit Ihnen, Frau Kurz. Zufrieden mit den Erklärungen von Herrn Alt und Herrn Wort?
|

|
Ja, das klingt recht plausibel. Allerdings: Früher hieß es wāge. Aber warum scheiben wir denn dann heute Waage mit zwei a?
|

|
Vielleicht kann ich Ihnen hier weiterhelfen. Schon im Mittelalter wurden einige gleich klingende Wörter unterschiedlich geschrieben. Das hat sich vor allem dann so entwickelt, wenn diese einen verschiedenen Ursprung hatten, z. B. die Saite (Musikinstrument), die Seite (Buchseite) oder die Wahl (wählen), der Wal (Meeressäugetier). Nach der Rechtschreibreform von 1901 wurden diese verschiedene Schreibweisen festgeschrieben. Damals schrieb man der Wagen (zur Fortbewegung) und die Wagen (Mehrzahl von der Wage) nur mit einem einfachen a.
|

|
Ein übereifriger preußischer Beamter befürchtete Verwechslungen zwischen der Mehrzahl von die *Wage (= die *Wagen) und dem Pferdewagen (= der Wagen, die Wagen). Klicke auf das Bild, wenn du das Original-Dokument ansehen und den Erlass lesen möchtest.
|
| Dies war allerdings sehr dumm, da mit dem Wort Waage gegen das wichtigste Prinzip der Vokalverdopplung (Doppelvokale kommen nur in einsilbigen Wörtern vor) verstoßen wird. Aber vielleicht kannte man damals ja dieses Prinzip noch nicht (und mich konnten sie ja auch noch nicht fragen).
|